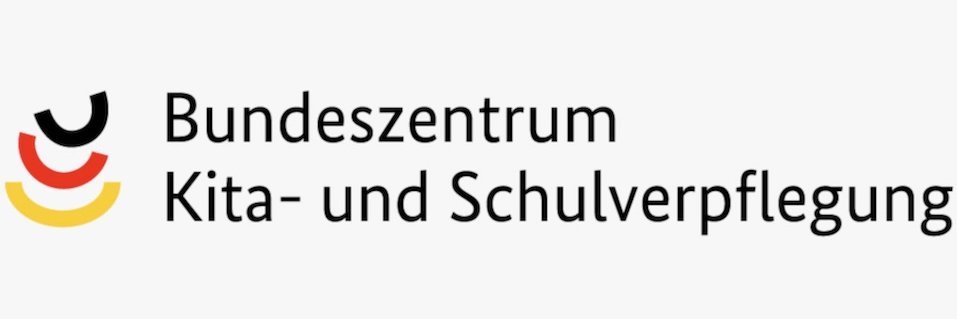- Die Verzahnung von Unterricht und Schulverpflegung beginnt mit Reflexionen, Beobachtungen, Umfragen, Akteursanalysen, Interviews und Exkursionen, z. B. zum eigenen Caterer.
- Hier finden Sie Materialien für Unterricht oder AGs, die dabei helfen, Veränderungen im Kleinen auszuprobieren.
- Zahlreiche Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Schulen liefern Ideen für eine langfristige Verknüpfung von Unterricht und Schulverpflegung
- Besonders erfolgversprechend sind systemische Ansätze, die Caterer und weitere Entscheidungsträger mit ins Boot holen.
Warum Ernährungsbildung und Schulverpflegung zusammendenken?
Ernährungsbildung findet nicht nur im Unterricht, sondern bei jeder Mahlzeit statt – und damit auch in der Frühstückspause und beim Mittagessen in Schulen und den dazugehörigen Betreuungseinrichtungen. Darin liegt eine große Chance: Schule kann Ernährungsgewohnheiten prägen. Kinder und Jugendliche können dort Neues kennenlernen und ausprobieren: Zum einen neue Lebensmittel und einen wertschätzenden, genussvollen Umgang damit. Zum anderen können sie im Unterricht und durch die Mitgestaltung ihrer Pausen selbst aktiv werden und verschiedene Kompetenzen erwerben. Neben Ernährungskompetenz sind das Gestaltungs- und soziale Kompetenzen.
„Können Kinder über die Verpflegung mitbestimmen und sich aktiv einbringen, sind sie nicht nur zufriedener mit den Mahlzeiten, sondern erwerben auch wichtige Kompetenzen“ (Quelle: Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung)
Von kleinen Aktionen bis zu den großen Schritten
Doch wie kann die Verzahnung von Schulverpflegung mit Ernährungsbildung gelingen? Welche Ansätze haben sich bewährt? Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Reihe spannender Ideen und Projekte vor.
Wer im Unterricht lernt, wie eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung aussieht, darf sich fragen: Finde ich an meiner Schule überhaupt ein entsprechendes Angebot? Wenn ja, ist dieses mindestens genauso attraktiv, wie andere Optionen? Und wenn nein: was kann ich daran ändern? Die Antwort: Vieles, aber nicht alles auf einmal. Deshalb lohnen sich auch die kleinen Schritte, die wir im Folgenden zuerst beschreiben. Sie können durchaus zum großen Ziel beitragen: ein schulisches Gesamtkonzept für eine gelingende Ernährungsbildung und eine dauerhaft hochwertige Schulverpflegung.
Noch weiter geht der Whole Institution Food Approach des BZfE. Er verzahnt nicht nur Ernährungsbildung und Schulverpflegung, sondern betrachtet systemisch das gesamte Schulleben und motiviert zu Veränderungen in der Schulkultur. Dabei ist auch hier klar: Der Weg ist das Ziel und jeder Schritt zählt. Fangen wir an!
Analysieren und verstehen
Um etwas zu verändern, muss man es verstehen. Die Verzahnung von Unterricht und Schulverpflegung beginnt also mit Reflexionen, Beobachtungen, Umfragen, Akteursanalysen, Interviews und Exkursionen: Was bieten uns Cafeteria und Mensa an? Wo kommt das Essen her? Wer entscheidet mit, was es gibt? Wie sehen die Beteiligten das Thema? Mit diesen Fragen kann Unterricht den Grundstein legen, um Veränderungen in der Mensa anzustoßen.
Passendes Unterrichtsmaterial:
Schülerinnen und Schüler reflektieren ihr eigenes Essverhalten und versetzen sich dann in unterschiedliche Gäste der Schulmensa. Anschließend überlegen sie, wie sie diese zu klimagesünderem Essen motivieren könnten.
Arbeitsblatt: Klimacheck aus “Was hat unser Essen mit dem Klima zu tun?”
Arbeitsblatt: Persona-Methode (externer Link, 401 KB, 2 Seiten, nicht barrierefreie PDF-Datei)
Der Check unterstützt Schülerinnen und Schüler, das Angebot am Schulkiosk (oder der Mensa) unter verschiedenen Gesichtspunkten zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Eine Briefvorlage hilft, die Änderungswünsche an den Mensa-Ausschuss weiterzugeben.
Arbeitsblatt aus SchmExperten “Checkt den Schulkiosk" und “Brief an den Mensaausschuss”
Schülerinnen und Schüler analysieren den Speiseplan ihrer Mensa, beobachten die Ausgabe- und Essenssituation und befragen einzelne Gäste. Im Anschluss hinterfragen sie, ob es den Gästen leicht gemacht wird, sich klimagesund zu verhalten.
Fragebogen: Speiseplancheck (externer Link, 516 KB, 2 Seiten, nicht barrierefreies PDF-Formular)
Schülerinnen und Schüler führen ein Gespräch mit ihrem Caterer, z. B. mit jemandem von der Ausgabe oder noch besser aus der Betriebsleitung. So erfahren sie mehr über die Hintergründe und lernen die Perspektive der „anderen Seite“ kennen.
Interviewleitfaden aus “Was hat unser Essen mit dem Klima zu tun?”
Veränderungen im Kleinen ausprobieren
"Was können wir als Schülerinnen und Schüler schon verändern?". Die folgenden Beispiele zeigen, wie Jugendliche Engagement üben und dabei für das Leben lernen. Sie setzen sich für vorübergehende Veränderungen in ihrer Mensa ein und können damit durchaus den Ball ins Rollen bringen. Darüber hinaus sammeln sie Erfahrung in Team- und Projektarbeit und erleben Partizipation.
Passendes Unterrichtsmaterial:
Wie wäre es, in der Schulmensa mal wie im Restaurant bedient zu werden? Das Unterrichtsmaterial "Unser Restaurant-Tisch" zeigt, wie Schülerinnen und Schüler diese Idee umsetzen und ausgewählten Mitschülerinnen und Mitschülern das Essen in besonderer Atmosphäre servieren können. Das setzt die Reflexion über die Essatmosphäre in Gang.
Schülerinnen und Schüler ermitteln die Tellerreste pro Mensagast, fragen nach den Gründen und initiieren Veränderungen bei der Essensausgabe sowie beim Speisenangebot.
Grafik: Tiere für den Müll (externer Link, 303 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei)
Arbeitsblatt: Tellerreste-Challenge (externer Link, 229 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei
Vorlage: Wiegeprotokol (externer Link, 229 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei)
Information Mensateam: Tellerreste (externer Link, 238 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei)
In enger Zusammenarbeit mit dem Caterer organisieren Schülerinnen und Schüler eine Probieraktion. Dafür wählen sie aus einer Rezeptliste vegetarische Gerichte aus und bewerben sie am jeweiligen Angebotstag. Die beliebtesten Gerichte nimmt der Caterer später in den Speiseplan auf.
Übersicht: Rezeptdatenbanken (externer Link, 262 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei)
Rezeptempfehlung (externer Link, 262 KB, 1 Seite, nicht barrierefreie PDF-Datei)
Schülerinnen und Schüler bewerben vegetarische Gerichte und bauen pro Klasse eine Zählstation auf. Wenn der Caterer Vorher-Nachher-Bestelldaten zur Verfügung stellt, können die Schülerinnen und Schüler den Erfolg ihrer Werbekampagne beurteilen.
Eine Liste mit Nudging-Ideen hilft den Schülerinnen und Schülern eine passende Aktion für ihre Mensa zu finden, z. B. Obst auch nochmal an der Kasse anbieten. Gemeinsam mit dem Caterer setzen sie diese Aktion um.
Der Verein BildungsCent e.V. hat Ideen für ein Klima-Frühstück in der Schule zusammengetragen. Dafür können vorab Kriterien festgelegt werden, zum Beispiel möglichst verpackungsfreie oder regionale und saisonale Produkte mitbringen.
Schülerfirmen gründen: Dann geht’s lecker zu
Noch viel mehr Möglichkeiten zur Gestaltung der Schulverpflegung bieten Schülerfirmen. Hier können die Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend Aspekte der Wirtschaftslehre, der Mathematik, aus Biologie und Ernährungsbildung mit allen Sinnen begreifen. Und das im Team.
Beispiele aus der Praxis:
Die Regelschule Goetheschule in Eisenach trägt den Titel „Umweltschule in Europa“. In diesem Rahmen wurde vor über zehn Jahren eine Schülerfirma gegründet, die in einem Multifunktionsraum dreimal pro Woche ein Frühstück aus regionalen und saisonalen Zutaten (oft in Bioqualität) anbietet.
Auch den Schulkiosk der weiterführenden Frieda-Stoppenbrink-Schule in Hamburg betreiben Schülerinnen und Schüler. Immer im Wechsel übernimmt eine Schulklasse für einen festgelegten Zeitraum den Kiosk, geht einkaufen, belegt Brötchen, schneidet Rohkost und verkauft diese schließlich in der großen Pause.
Der Schulkiosk Schmackofatz der Nahetal-Schule in Idar-Oberstein ist verknüpft mit der Lebensweltklasse. Die Schülerinnen und Schüler bereiten frische Brötchen und an bestimmten Tagen auch Obstsalat mit Naturjoghurt oder Müsli zu. Im Unterricht wird die Praxis fächerübergreifend verknüpft mit Preiskalkulation, Wareneinkauf und dem Umgang mit Geldbeträgen.
In der Förderschule Gutzmannschule im niedersächsischen Langenhagen zieht sich der Themenbereich Ernährung ganzheitlich in unterschiedlichen Niveaustufen durch alle Jahrgänge. Dazu gehört beispielsweise die Schülerfirma Essbar, die wöchentlich frische Pausensnacks für die Schulgemeinde herstellt.
Kochen für die Schulgemeinde: Sinnvoll und lehrreich
Besitzt eine Schule eine große Küche, eröffnen sich weitere spannende Ansatzpunkte. Im Folgenden finden Sie drei Beispiele aus Förderschulen, in denen Schülerinnen und Schüler das Mittagessen für die gesamte Schulgemeinde kochen. Selbstbestimmter geht es nicht.
Beispiele aus der Praxis:
Gekocht wird in der Haupt- und Realschule mit Förderstufe Adolf-Reichwein-Schule im hessischen Heusenstamm schon immer. Das ist Teil des Hauswirtschaftsunterrichts. Inzwischen sorgen Schülerinnen und Schüler auch für die Mittagsverpflegung. Durch die Zusammenarbeit mit dem Schulgarten ist das Angebot teilweise vom regionalen Saisonkalender geprägt.
Auch in der Salierschule Schifferstadt schwingen die Schülerinnen und Schüler die Kochlöffel. In der Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kocht jeden Tag ein anderes, dreiköpfiges Team aus den Klassen 7 bis 9 das Mittagessen für alle. Drei weitere Schülerinnen und Schüler räumen auf. Bevor die Schülerinnen und Schüler an den Herd dürfen, erhalten sie in den Klassen 6 und 7 das theoretische Fundament dazu.
An zwei Tagen pro Woche kochen Schülerinnen und Schüler der Schule am Siel in Nordenham für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Schule ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Auch an den Rezepten dürfen sie mittüfteln. Im Rahmen des Wettbewerbes „Schule auf ESSKurs“ wurde das Mensa-Konzept mehrfach prämiert und mit „Sternen“ ausgezeichnet.
Systemisch denken: Caterer und lokale Akteure ins Boot holen
Besonders erfolgversprechend sind ganzheitliche Ansätze. Je mehr Beteiligte an demselben Strang ziehen, desto besser. Im folgenden finden Sie drei ganz unterschiedliche Projekte. Gemeinsam ist ihnen, dass sie auch die Schul-Caterer und teilweise die lokale Landwirtschaft ins Boot holen. Wenn neben der Ernährungsbildung im Unterricht und der Schulverpflegung noch weitere Handlungsfelder einer Schule ins Spiel kommen, sprechen Fachleute von einem "Whole Institution/School Approach”. Den verfolgt insbesondere das erstgenannte EU-Projekt.
Beispiele aus der Praxis:
Mit dem Ziel, eine gesunde und nachhaltige Verpflegung in Schulen zu etablieren und so die Ernährungswende voranzutreiben, startete das EU-finanzierte Projekt schoolfood4change im Frühjahr 2022. Für Deutschland sind Nürnberg und Essen Städtepartner. Ein Handlungsfeld ist beispielsweise der „Whole School Food Approach“. Anstelle nur das Speisenangebot umzustellen, nimmt dieser Ansatz die gesamte Schulgemeinschaft in den Blick. Weitere Säulen des Projektes beschäftigen sich mit der Suche nach lokalen Beschaffungslösungen und der Beratung von Küchenkräften und Caterern. Auch die Schülerinnen und Schüler werden an den Veränderungsprozessen aktiv beteiligt.
Kontakt Essen: Grüne Hauptstadt Agentur, Vera Stöbel: vera.stoebel@gha.essen.de
Kontakt Nürnberg: Amt für Allgemeinbildende Schulen, Christian Sandner Christian.Sandner@stadt.nuernberg.de
Wissen über die Herkunft ihres Mittagessens sammelten Berliner Grundschülerinnen und -schüler bei dem Projekt „Wo kommt Dein Essen her?“. Das Projektziel: den Anteil regionaler Bio-Lebensmittel in der Verpflegung erhöhen, die Wertschöpfung in der Region Berlin-Brandenburg stärken und das Thema Ernährung auch in seinen ökologischen und sozialen Facetten in den Unterricht bringen. Obwohl das Projekt ausgelaufen ist, finden sich auf der Website des Projektes “Wo kommt dein Essen her?” noch tolle Videos und interaktive Elemente, die nicht nur für Berliner Schulen interessant sind.
Die Modul-Box „Nachhaltige Ernährung“ unterstützt bundesweit Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte sowie Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen bei der partizipativen Mitgestaltung einer gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Schulverpflegung, der Verknüpfung von Bildung und Schulverpflegung sowie dem Transfer hin zu einer nachhaltigen Ernährung. Das Herzstück bildet der modulare Mensa-Talk, bei dem Schülerinnen und Schüler mit ihrem Essensanbieter ins Gespräch kommen. Zusätzlich bietet der Bereich „Wissenstransfer“ eine umfangreiche Sammlung an direkt einsetzbaren Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen.
Fazit: Trotz kleiner Schritte das große Ziel nicht aus den Augen verlieren
Es gibt viele Möglichkeiten, um Ernährungsbildung mit Schulverpflegung zu verzahnen. Kleine Aktionen und Projekte machen Sinn, um den Ball ins Rollen zu bringen. Selbst wenn dies keine dauerhafte Veränderung bringen sollte, üben Schülerinnen und Schüler dabei, sich gemeinsam zu engagieren. Das stärkt ihre Selbstwirksamkeit und erweitert ihre Gestaltungskompetenzen.
Damit Schule doppelt profitiert und die Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein ausgewogeneres und nachhaltigeres Essen bekommen, braucht es einen systemischen Ansatz und dauerhafte Strukturen. Das Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung empfiehlt beispielsweise die Gründung eines Verpflegungsausschusses und die Benennung eines Verpflegungsbeauftragten. Weitere Infos zur Qualitätsentwicklung in der Schulverpflegung auf der Website des Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung.
Weitere Unterstützungsangebote für Schulen und Lehrkräfte
Kostenfreie Fortbildung zur "Schul-AG Klimagesunde Mensa"
Zu dem in diesem Artikel vorgestellten Lernangebot „Schul-AG: Klimagesunde Mensa“ (siehe zum Beispiel Aktionsbaustein „Tellerreste-Challenge“) bietet die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen auch eine (Online-)Fortbildung für Lehrkräfte an.
Brettspiel und Zukunftswerkstatt "Vision Mensa"
Das Brettspiel nutzt den Gamification-Ansatz, um Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 für Veränderungen in der eigenen Mensa zu motivieren. Es unterstützt einen Perspektivwechsel, den es auch für die sich anschließende Zukunftswerkstatt braucht. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Sachsen bietet das Brettspiel zum Verleih an.
Die Broschüre vom Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg liefert Unterrichts- und Projektvorschläge, um den Essalltag in Schulen mit der Bildung zu verknüpfen.
Impulse für gelebte Partizipation, praktische Umsetzungsvorschläge und Rezepte für den Schulkiosk bietet die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW.
Fachinformation: Schüler kochen für Schüler
Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hessen informiert über wichtige Rahmenbedingungen, um Kinder an der Zubereitung des Schulessens zu beteiligen.
Ganzheitliches Programm FOOD'N SCHOOL
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet eine besondere Unterstützung: Schulen, die das Schulessen mit allen Beteiligten anpacken und gemeinsam eine gesundheitsfördernde, nachhaltige und bewusste Esskultur schaffen möchten, können sich ab sofort beim Programm FOOD'N SCHOOL bewerben.
Kostenlose Fortbildung "Ernährungsbildung zwischen Lust und Frust"
Kindern und Jugendlichen Lust auf vielfältiges und pflanzenbetontes Essen zu vermitteln, kann viel Freude machen. Aber es kann auch frustrierend sein, wenn das im Schulalltag so gar nicht funktionieren will. Wie kann Ernährungsbildung also in der Praxis besser gelingen? Das erfahren Sie in dieser dreistündigen Web-Fortbildung.
Fortbildung “Ernährungsbildung zwischen Lust und Frust”: Anmeldung und Termine
Gemeinsam gut essen!
Sie möchten die Verpflegung in Ihrer Schule, Kita oder Kindertagespflegeeinrichtung verbessern? Sie suchen eine Fortbildung, benötigen Material oder Unterstützung vor Ort?
Das Bundeszentrum Kita- und Schulverpflegung ist Ihr zentraler Ansprechpartner rund um gesundes Essen in Kindertagesbetreuung und Schule.